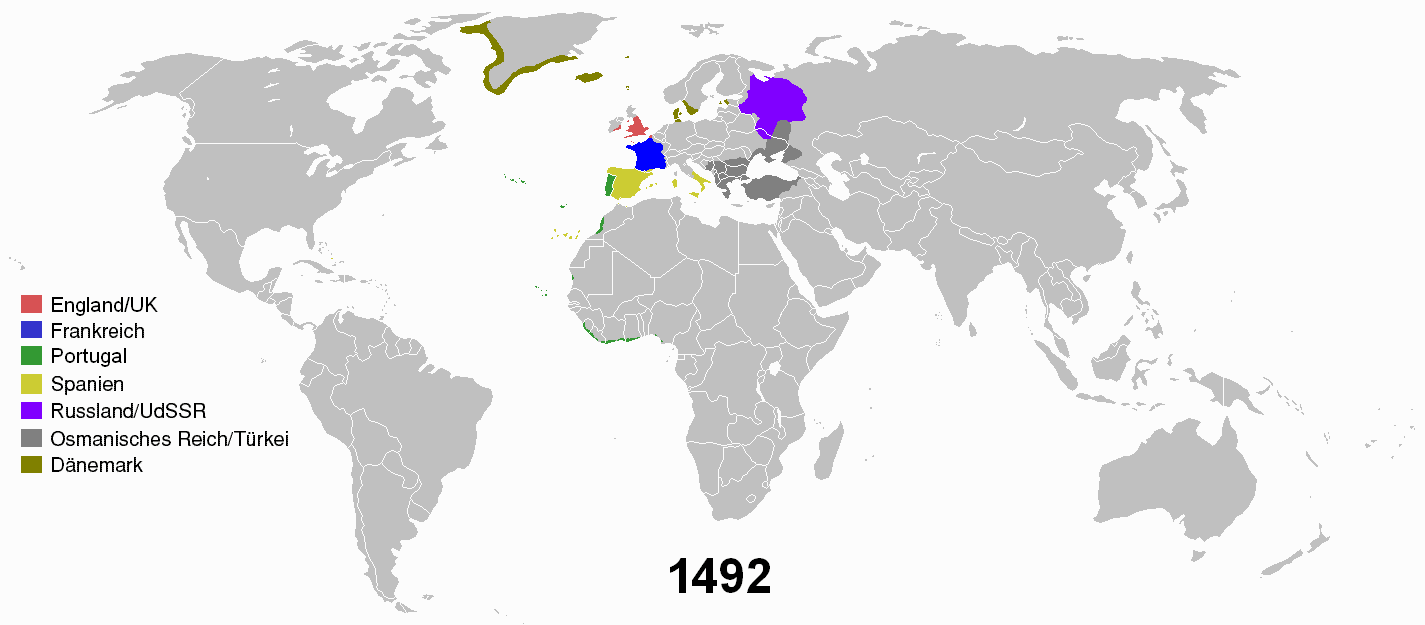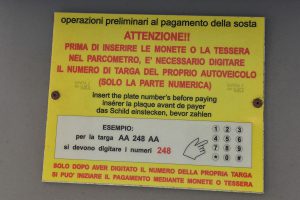Europas Kolonialgeschichte prägt die Welt bis heute. Doch was genau war Kolonialismus? Wer war beteiligt und warum?
Die gesamte Kolonialgeschichte Europas lässt sich natürlich nicht in einem Artikel schildern. Daher versuchen wir hier, einen kompakten Überblick über die Hintergründe, Ausbreitung und Auswirkungen des europäischen Kolonialismus ab dem 15. Jahrhundert zu geben.
Dabei liegt unser Fokus auf den Motiven, den Akteuren und den langfristigen Folgen bis in unsere Gegenwart. Ergänzt mit einigen Details und Geschichten, die noch wenig bekannt sind.
Welche Länder waren die größten Kolonialmächte?
- Spanien und Portugal (ab dem 15. Jahrhundert)
- Niederlande, England, Frankreich (ab dem 17. Jahrhundert)
- Deutschland, Belgien, Italien (später im 19. Jahrhundert)
Jede dieser Nationen hinterließ ihre Spuren auf mehreren Kontinenten – mit teils drastischen und menschenverachtenden Auswirkungen.
Zeitleiste: Die wichtigsten Etappen der Kolonialgeschichte
- 1415 Portugal erobert Ceuta – Beginn des europäischen Kolonialismus
- 1492 Kolumbus entdeckt Amerika für Spanien
- 1494 Vertrag von Tordesillas teilt die Welt zwischen Spanien und Portugal auf
- 1600–1700 Aufstieg der Niederlande, Englands und Frankreichs zu Kolonialmächten
- 1756–1763 Siebenjähriger Krieg – Großbritannien wird führende Kolonialmacht
- 1776 Unabhängigkeitserklärung der USA – erstes großes Kolonialgebiet fällt
- 1800–1830 Beginn der Unabhängigkeitsbewegungen in Lateinamerika
- 1884/85 Berliner Kongokonferenz – „Wettlauf um Afrika“ wird organisiert
- 1914–1918 Erster Weltkrieg – Deutschland verliert alle Kolonien
- 1947 Indien wird unabhängig – Beginn der Dekolonisation
- 1954–1962 Algerienkrieg – Frankreich verliert Algerien
- 1960 „Afrikas Jahr“ – 17 afrikanische Staaten werden unabhängig
- 1975 Portugal gibt Angola, Mosambik und andere Kolonien auf
- 1997 Rückgabe Hongkongs von Großbritannien an China
Wie war die Vorgeschichte des Kolonialismus?
Mehr als 1.500 Jahre lang wurden der Handel und der Austausch zwischen Europa und Asien vorwiegend über das Netz der – erst 1877 sogenannten – “Seidenstraße” auf einem 6.400 km langen Landweg abgewickelt.
Spätestens aber als die Osmanen 1453 Konstantinopel eroberten, gelangte der Handel vollständig unter muslimische Kontrolle. Die mächtigen Stadtstaaten Genua und Venedig sicherten sich Monopolrechte im Warenumschlag mit dem Osmanischen Reich und Asien.
Welche Rolle spielten neuartige Waffen?
Schieß- oder Schwarzpulver wurde in China erfunden. Die Kenntnis darüber gelangte über die Seidenstraße nach Europa. Mitte des 14. Jahrhunderts kamen Kanonen bereits bei Belagerungen zum Einsatz. Aber erst als wendigere Geschütze in den nächsten Jahrzehnten entwickelt wurden, eigneten sie sich auch für die Verwendung auf Schiffen. Das revolutionierte die Schiffsbewaffnung und zog eine Änderung der Seekriegsführung nach sich. Der Kampf wurde mehr und mehr auf die Entfernung ausgetragen.
Am 20. August 1415 konnten die Portugiesen die afrikanische Stadt Ceuta vom Meer aus innerhalb eines Tages erobern.
Das läutete den Beginn der Kolonialisierung ein.

Warum suchten die Europäer nach einem Seeweg nach Indien?
Um die islamischen Länder und deren Kontrolle zu umgehen, suchten die Europäer nach einem Seeweg nach Indien, um direkt mit Chinesen und Indern zu handeln. Seide, Baumwolle oder Gewürze wie Pfeffer, Gewürznelken, Muskat oder Zimt stellten einen immensen Wert dar. Denn sie wurden nicht nur zum Würzen von Speisen verwendet, sondern waren auch als Konservierungsstoffe und Grundlage für Arzneimittel unverzichtbar.
Ihnen wurde auch eine Heilwirkung gegen die Pest zugesprochen, die Mitte des 14. Jahrhunderts über die Seidenstraße eingeschleppt wurde und die europäische Bevölkerung drastisch dezimiert hatte..

Wo entstanden die ersten Kolonien?
Die ersten kolonialen Stützpunkte entstanden an den Küsten Afrikas, Asiens und vor allem in Südamerika.
Portugal sicherte sich z. B. Brasilien, Spanien weite Teile Lateinamerikas. Die Niederlande, Frankreich und England konzentrierten sich später auf Indien, Indonesien, Afrika und Nordamerika.
Wie sich die Kolonialmächte die Welt von 1492 bis 2008 aufteilten, seht ihr in der nachfolgenden Animation auf Wikipedia:
Aufstieg und Fall der großen Kolonialmächte im Überblick
Im Laufe von 500 Jahren existierten sie nebeneinander oder wechselten sich in ihrer Kolonialherrschaft ab. Jede Nation hatte ihre eigenen Motivationen und Ausgangsvoraussetzungen.
Portugal: Erster Sklavenmarkt
Kurzinfos Portugal
Beginn: 1415 mit der Eroberung von Ceuta in Nordafrika
Besonderheit: Portugal war das erste europäische Land, das systematisch überseeische Gebiete eroberte – und eines der letzten, das sie wieder abgab.
Wichtige Kolonien:
- Brasilien (1500–1822)
- Angola, Mosambik, Guinea-Bissau (bis in die 1970er-Jahre)
- Goa (Indien), Macau (China), Osttimor
Wirtschaftlicher Fokus: Gewürzhandel, Sklavenhandel, Zuckerrohr und später Kaffee
Spuren heute: Portugiesisch ist noch immer Amtssprache in vielen ehemaligen Kolonien, z. B. in Brasilien, Angola oder Mosambik.
Warum begann die Kolonialgeschichte Europas mit Portugal?
Für das Königreich Portugal war zunächst weniger das Streben nach Macht und Prestige als mehr die Armut des Landes der Anlass, ihr Machtgebiet außerhalb Europas auszudehnen.
Das Land hatte nur einige Jahrzehnte zuvor die arabische Besatzer vertrieben. Das neue Königreich hatte im 14. Jahrhundert Schwierigkeiten, seine Bevölkerung zu ernähren. Getreide musste u. a. in Marokko, der damaligen Kornkammer Afrikas, eingekauft werden. Es wurde als Schande empfunden, Nahrungsmittel aus dem muslimischen Maghreb einführen zu müssen.
So entstanden Pläne, das marokkanische Ceuta an der Küste des Mittelmeers zu erobern, den Hauptumschlagsplatz der Handelswege aus Afrika.
Heinrich der Seefahrer
Die schnelle Eroberung 1415 von Ceuta (heute in spanischem Besitz) beflügelte die weiteren Expansionsversuche unter Heinrich dem Seefahrer. Das Zeitalter der Entdeckungen hatte begonnen.
Auch die katholische Kirche war ein entscheidender Faktor. Sie sah in einer Eroberung die Möglichkeit, heidnische Gebiete zu missionieren.
In der Folge wurden 1419 zunächst die unbewohnte Insel Madeira und 1427 die Azoren in Besitz genommen. Der erfolgreiche Anbau von Zuckerrohr auf Madeira spülte Geld in die Kassen. Da dafür allerdings viele Arbeitskräfte gebraucht wurden, begann Portugal 1444 mit dem Sklavenhandel aus Afrika.
Im Museu de Marinha, dem wichtigsten Museum der Schifffahrt in Lissabon, ist die Geschichte des Sklavenhandels nur eine Randnotiz.
1482 war Kapitän Diogo Cão bis zum Kongo und nach Angola vorgedrungen. Dort setzte er den ersten steinernen Padrão mit Kreuz, um die entdeckten und teilweise in Besitz genommenen Gebiete zu markieren.
Vasco da Gama
Dennoch blieb eines der wichtigsten Ziele, den Seeweg nach Indien zu finden, um damit den lukrativen Gewürzhandel unter die Kontrolle Portugals zu bringen.
1498 schaffte es Vasco da Gama um den südlichen Zipfel Afrikas herum den indischen Subkontinent zu erreichen. Schnell stieg Portugal damit zu einer Wirtschaftsmacht auf und begann ein Kolonialreich aufzubauen.
Im Jahr 1500 wurde Brasilien entdeckt, besiedelt und ausgebeutet. Der in Madeira erprobte Zuckerrohranbau wurde nach Brasilien exportiert und intensiviert.
Wie kam Brasilien zu seinem Namen?
Der sogenannte Dreieckshandel mit Sklaven aus Afrika begann nur etwa ein Jahr später.
In den folgenden 400 Jahren wurden geschätzt etwa 12,5 Millionen Sklaven aus Afrika in die neuen Kolonien verschleppt. Einige Quellen beziffern die Zahl auf 40 Millionen. Etwa jeder 8. Mensch starb bereits während der Überfahrt.
“Jeder Mensch ist ein eigenes Universum.“ — Bob Marley
Portugals “glückliche Zeit”
Das anschließende 16. Jahrhundert war Portugals Blütezeit. Durch optimierte Schiffe und verbesserte Navigationsinstrumente beherrschte es den Indischen Ozean und den kompletten Indienhandel. Hinzu kamen die Gewinne aus den importierten Rohstoffen aus Brasilien.
Die Reichtümer aus dem Handel mit Indien und Afrika galten als Privateigentum des portugiesischen Königs. Unter Manuel I., „dem Glücklichen“, wurden sie in Prunkbauten und Hofhaltung investiert. Der besondere Manuelinische Architektur-Stil entstand. Weitere Profiteure der Handelsgewinne waren die Kirche, der Adel und das Großbürgertum, das sich an den Fahrten mit Investitionen beteiligte. Der Großteil des Volkes hatte kaum etwas davon.
Ab 1594 begann durch Korruption, verlorene Schlachten in Marokko und dem Aufstieg der Niederlande zur Seemacht der allmähliche Niedergang.
Spanien übernimmt Portugal
Zudem entstand 1580 nach dem Tod von König Heinrich I. ohne Nachfolger ein Machtvakuum. Philipp II. von Spanien übernahm Portugal und führte beide Länder in Personalunion.
Erst 1640 wurden die Spanier durch den Herzog von Braganza vertrieben, der sich als König Johann IV. den portugiesischen Thron sicherte.
Im 17. Jahrhundert flossen durch Gold- und Diamantenfunde im Gebiet Minas Gerais (Allgemeine Minen) in Brasilien und den späteren Kaffeeanbau noch einmal erhebliche Mittel nach Portugal.
Aber 1822 war damit endgültig Schluss, als sich Brasilien als unabhängiges Kaiserreich erklärte.
Spanien: Die Gier nach Gold
Kurzinfos Spanien
Beginn: 1492 mit der „Entdeckung“ Amerikas durch Kolumbus
Besonderheit: Schuf ein riesiges Imperium in Mittel- und Südamerika.
Wichtige Kolonien:
- Mexiko, Peru, Kuba, Philippinen, große Teile Südamerikas
- Später auch Teile Nordafrikas
Wirtschaftlicher Fokus: Gold, Silber, Zucker, Missionierung
Die Conquista führte zur Zerstörung ganzer Kulturen wie den Azteken und den Inkas. Eingeschleppte Krankheitserreger führten zur drastischen Dezimierung der indigenen Bevölkerung.
Spuren heute: Spanisch ist eine der am meisten gesprochenen Sprachen weltweit. Katholizismus und viele kulturelle Bräuche gehen auf die Kolonialzeit zurück.
Wie kam Spanien zum Kolonialismus?
Der damals auf Madeira lebende Christoph Kolumbus bat zunächst den portugiesischen König Johann II. um Unterstützung. Seine Idee war das Projekt der Erforschung eines westlichen Seewegs nach Indien. Aber der König lehnte ab, weil er den (tatsächlich falschen) Berechnungen von Kolumbus über den Erdumfang nicht glaubte.
So wandte sich Kolumbus an das spanische Herrscherpaar Ferdinand II. von Aragón und Isabella I. von Kastilien. Die befanden sich aber gerade noch im Krieg mit dem Emirat von Granada.
Erst nach dem Sieg über die letzte muslimische Bastion Granada am 2. Januar 1492 akzeptierten sie seine Bedingungen. Kolumbus kam gerade rechtzeitig noch an, um die Kapitulation des Maurenfürsten Muhammad XII. mitzuerleben.
Entdeckung Amerikas
Im August konnte Kolumbus seine Reise in Sevilla starten und landete am 12. Oktober 1492 in Amerika. Noch lange Zeit danach glaubte er, Indien entdeckt zu haben.
Zwei Jahre später teilten Portugal und Spanien die Welt im Vertrag von Tordesillas unter sich auf.
Damit verfolgte Spanien denselben Zweck wie die Portugiesen: sich von den italienischen Städten unabhängig zu machen, um an Waren des Orients zu gelangen. Diese Stadtstaaten hatten es vorgemacht: Mit einem Handelsmonopol sichert man sich Macht, Reichtum und Einfluss.
Capitulación-Verträge
Allerdings gingen die Spanier dabei anders vor. Die kastilische Krone hatte nach den Kriegen gegen die Mauren nicht die erforderlichen Mittel, um die Eroberungsfeldzüge zu finanzieren. Daher schloss sie mit einzelnen Unternehmern oder Unternehmensgruppen sogenannte Capitulación-Verträge und sicherte sich ihren Anteil an zu erwartenden Gewinnen.
Gier nach Reichtum
So hatten diese Unternehmungen selbst dafür zu sorgen, ihre Expedition auszurüsten sowie Seeleute, Priester und bewaffnete Männer anzuwerben. Diese Konquistadoren waren weniger königliche Soldaten oder bezahlte Söldner, sondern Freiwillige, die sich für den Kauf ihrer Ausrüstung verschuldeten. Ihr Interesse war also darauf gerichtet, maximalen Gewinn aus der Expedition zu schlagen, um ihre Schulden zurückzuzahlen und ihr weiteres Einkommen zu sichern.
Zerstörung der Hochkulturen
Das oberste Ziel der Konquistadoren war nun nicht mehr der Handel mit Waren des Orients oder die Erschließung neuer Gebiete und deren Besiedlung. Sie wollten Gold, Silber oder andere Schätze finden. Diese Schatzjäger verhielten sich rücksichtslos und brutal gegenüber der indigenen Bevölkerung.
Aufgrund ihrer überlegenen militärischen Mittel und teilweise unterstützt durch unterworfene lokale Volksstämme gelangen ihnen erfolgreiche Feldzüge. Hernán Cortés eroberte und plünderte das Reich der Azteken und Francisco Pizarro das Großreich der Inka. Beide Reiche waren damals Hochkulturen. Auf deren Trümmern wurden die Vizekönigreiche Neuspanien und Peru gegründet.
1588 mit der Niederlage der spanischen Armada gegen England begann der Niedergang Spaniens als beherrschende Kolonialmacht.
Frankreich: Das gespaltene Erbe
Kurzinfos Frankreich
Beginn: 17. Jahrhundert mit Kolonien in Kanada und der Karibik
Besonderheit: Frankreich legte großen Wert auf Assimilation, die Anpassung der indigenen Bevölkerung an die französische Kultur.
Wichtige Kolonien:
- Kanada (Neufrankreich), Haiti, Martinique, Guadeloupe
- Algerien, Marokko, Tunesien, große Teile West- und Zentralafrikas
- Indochina (Vietnam, Laos, Kambodscha), Syrien, Libanon
Wirtschaftlicher Fokus: Plantagenwirtschaft, Rohstoffe, später kultureller Einfluss
Spuren heute: Französisch ist in vielen Ländern Afrikas Verkehrssprache. Die Kolonialgeschichte ist in Frankreich nach wie vor ein politisch heikles Thema (siehe die Debatte um den Algerienkrieg).
Welche Rolle spielte Frankreich?
Frankreich hatte den Hype um die neuen Länder und Seewege zunächst verschlafen. Das Land konkurrierte zur damaligen Zeit im Zuge der Italienischen Kriege seit 1495 mit Spanien um die Vormachtstellung in Europa.
Erst 1534 entsandte König Franz I. den französischen Seefahrer Jacques Cartier, um eine Nordwestpassage nach Indien über Nordamerika zu erforschen.
Nordwestpassage nach Indien
Cartier vermutete den breiten Sankt-Lorenz-Strom als Passage und segelte tiefer ins Land hinein. Als sich das als Sackgasse erwies, beanspruchte er die durchquerten Gebiete für Frankreich. Bei einer zweiten Reise benannte er einen imposanten Berg über einem Dorf der Indigene Mont Royal (königlicher Berg). Daher hat die heutige Stadt Montreal ihren Namen.
In den Jahren danach wurden zwar kaum Bodenschätze gefunden, aber der Handel mit Biberpelzen brachte ein Vermögen ein. Denn beim Adel in Frankreich und in England waren sie heißbegehrt. Aber auch für Hüte, Mützen, Strümpfe oder Handschuhe war Biberfell geeignet. Biberpelze erhielten den Status eines Zahlungsmittels. Die Biberpopulation wurde dadurch nahezu ausgerottet.
Aber erst 1603 begann die systematische Erkundung und Kolonialisierung der Gebiete im Osten Kanadas durch Samuel de Champlain, den Gründer Neufrankreichs.
1718 wurde La Nouvelle-Orléans gegründet, das heutige New Orleans.
Um 1750 reichte das Gebiet von Kanada im Norden bis zum Golf vom Mexiko.
Karibik und Südsee
Es folgten Erwerbungen in den karibischen Inseln und in einem Teil von Indien.
Die erste Weltumsegelung Frankreichs begann allerdings erst 1766 unter der Leitung von Louis Antoine de Bougainville. Auf dieser war auch die erste Frau dabei, Jeanne Barret, die die Bougainvillea entdeckte. Bougainville beanspruchte Tahiti und die umliegenden Insel für Frankreich und begründete damit das heutige Französisch-Polynesien.
Nach verlorenen Kriegen gegen Großbritannien musste Frankreich jedoch im sogenannten Frieden von Paris 1763 viele der eroberten Gebiete wieder abtreten. Das Land verlor sämtliche Kolonien in Nordamerika; unter anderem wurde auch Kanada britisch. Die wirtschaftliche Not nach den verlorenen Schlachten war einer der Auslöser der Französischen Revolution 1789.
Napoleon Bonaparte
Aus dieser wiederum ging Napoleon Bonaparte hervor, der knapp 10 Jahre später Ägypten besetzte. Ziel war es, Großbritanniens Zugang nach Indien zu stören.
1803 verkaufte Napoleon das noch verbliebene Louisiana (Neufrankreich) an die Vereinigten Staaten und Frankreich zog sich komplett aus Nordamerika zurück.
Afrika
Ab 1830 konzentrierte sich Frankreich wiederum auf Kolonien, diesmal in Afrika, beginnend an der Küste des Maghreb wie Algerien, und eroberte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert die gesamte Sahara sowie den größten Teil West- und Zentralafrikas.
Mit Indochina und einigen Besitzungen in China und Indien sowie großer Teile der Inselwelt im Indischen Ozean stieg Frankreich im 19. Jahrhundert zur zweitgrößten Kolonialmacht auf.
Die Niederlande: Handelsmacht mit Kolonialcharakter
Beginn: Anfang des 17. Jahrhunderts mit der Gründung der VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie)
Besonderheit: Die Niederlande bauten ein regelrechtes Handelsimperium auf, das stark wirtschaftlich geprägt war.
Wichtige Kolonien:
- Indonesien (Niederländisch-Ostindien)
- Suriname, Niederländische Antillen, Südafrika (Kapkolonie, bis 1806)
- Teilweise auch kurzzeitig Brasilien und Ceylon (Sri Lanka)
Wirtschaftlicher Fokus: Gewürzhandel, Kaffee, Zucker, Sklavenhandel
Spuren heute: In Indonesien ist die Kolonialzeit bis heute spürbar – in Architektur, Sprache (viele Lehnwörter), und der bitteren Erinnerung an die brutale Unterdrückung.
Warum kam es zum Aufstieg der kleinen Niederlande?
Durch die Judenverfolgung in Spanien und kurz darauf auch in Portugal gab es einen brain drain in tolerantere Gebiete. In der Republik der Sieben Vereinigten Niederlande herrschte Religionsfreiheit. Ein Zentrum der Einwanderung war Amsterdam. Die Stadt wurde ein innovation hub und zog die besten Köpfe und auch Kapital an.
Cornelis Corneliszoon van Uitgeest entwickelte windgetriebene Sägemaschinen, die den Schiffsbau etwa 30 Mal schneller und kostengünstiger machten. Die Schifffahrtsindustrie boomte und holländische Schiffe wurden auch an andere Länder verkauft.
1595 wurden die Niederländer nahezu konkurrenzlos, nachdem ein Schiffsbauer aus Hoorn die Fleute entwickelt hatte. Ein Frachtschiff, das dank seiner einfachen Segelkonstruktion mit einer kleineren Besatzung auskam.

Ende des Gewürzmonopols
Die Kolonialisierung begann 1594 mit den ersten Schiffexpeditionen der Voorcompagnien nach Indien. Mit der Ankunft in Bantam auf Java brach Kapitän Cornelis de Houtman 1596 das portugiesische Gewürzmonopol in Ostindien.
1602 wurde die Vereinigte Ostindien-Kompanie VOC gegründet und gab ein Jahr später erstmals Aktien heraus.
Reiche Niederländer konnten sich an der Gesellschaft beteiligen und erhielten bei Gewinnen Dividendenausschüttungen. So kam weit mehr Kapital zusammen, als Portugal aufbringen konnte.
Innerhalb weniger Jahrzehnte eroberten die Niederländer deshalb fast sämtliche portugiesische Handelsstützpunkte in Südostasien. Nach dem Vorbild der VOC wurde 1621 die Westindien-Kompanie gegründet, die sich Richtung Amerika wandte und zwischenzeitlich zum weltweit größten Sklavenhändler aufstieg.
1624 entstand Neu-Amsterdam, das heutige New York. Im selben Jahr wurde auch ein Teil Brasiliens erobert sowie weitere Kolonien an der Nordküste Südamerikas gegründet.
Goldenes Zeitalter
Um 1650 erreichte das niederländische Handelsimperium seinen Höhepunkt, als etwa die Hälfte des Welthandels von den Niederländern umgeschlagen wurde. Diese Epoche wird auch das Goldene Zeitalter der Niederlande genannt.
Im Gegensatz zu den anderen Nationen wollten die Niederländer keine Gebiete erobern, sondern gründeten Handelsniederlassungen. Sie ließen die lokalen Herrschaftsstrukturen größtenteils bestehen, diktierten aber, mit welchen Produkten zur Befriedigung der Bedürfnisse in Europa gehandelt wurde. Pfeffer, Tee, Kaffee und Textilien gehörten zu den bevorzugten Gütern.
Die Beschränkung rein auf den Handel geriet später jedoch zum Nachteil, wie die weitere Geschichte zeigt.
Großbritannien: Das größte Kolonialreich der Geschichte
Kurzinfos zu Englands Kolonialgeschichte
Beginn: 16. Jahrhundert, ab dem 18. Jahrhundert massiv ausgebaut
Besonderheit: „The empire on which the sun never sets“ – das Britische Empire war flächenmäßig das größte der Geschichte.
Wichtige Kolonien:
- Indien (Kronjuwel des Empire), Pakistan, Burma
- Australien, Neuseeland, Kanada
- Nigeria, Kenia, Südafrika
- Karibikinseln, Hongkong, Zypern, Malta, Falklandinseln
Wirtschaftlicher Fokus: Rohstoffe, Handelsmonopole, Arbeitskräfte
Spuren heute: Englisch ist heute Weltsprache. Das parlamentarische System, das Common Law und das Schulsystem Großbritanniens wurden in viele Länder exportiert – teils freiwillig, teils aufgezwungen. Viele Konflikte (z. B. in Palästina oder Indien) haben ihre Wurzeln in britischer Kolonialpolitik.
Wie schaffte es England, ein Weltreich aufzubauen?
Angespornt durch die portugiesischen und spanischen Erfolge wollte auch der damalige englische König Henry VII. einen westlichen Seeweg nach Asien finden. Die Erfolge der Expeditionen mit dem zu der Zeit noch kleinen englischen Schiffsverband waren jedoch bescheiden. Immerhin reformierte und baute er die englische Flotte aus, aus der sich später die Royal Navy entwickelte.
Trennung von der katholischen Kirche
1534 trennte sich sein Nachfolger Henry VIII. von der katholischen Kirche und gründete die protestantisch-anglikanische Kirche. Nicht aus theologischen Gründen, sondern weil der Papst in Rom ihm die Scheidung von seiner Frau untersagte.
Das führte zu Spannungen zwischen dem katholischen Spanien, das weiterhin innerhalb Europas seinen Machtbereich ausbauen wollte. Der 1517 durch Luther entstandene Protestantismus galt dort als Ketzerei.
Durch die eroberten neuen Gebiete stieg Spanien vorübergehend auch zu einer christlichen Weltmacht auf. Als 1516 Kaiser Karl V. als erster Habsburger den spanischen Thron bestieg, reichte sein Reich von Spanien bis zu den Niederlanden und Österreich.
Staatliche Piraterie
So verordnete 1562 die protestantische englische Krone unter Elizabeth I. eine staatlich autorisierte Piraterie. Englische Freibeuter wie John Hawkins und Sir Francis Drake sollten zunächst Überfälle auf westafrikanische Küstenstädte und portugiesische Schiffe verüben. So wollte man im lukrativen Sklavenhandel über den Atlantik mitmischen.
Als die Konfrontation mit Spanien immer heftiger wurden, gab Königin Elizabeth ihre formelle Zustimmung, auch spanische Städte auf dem amerikanischen Kontinent zu plündern.
Gleichzeitig sollten die aus der Neuen Welt zurückkehrenden, mit Schätzen beladenen spanischen Galeonen überfallen werden.
Piraten in der Karibik
Dieses Kapitel muss etwas näher beleuchtet werden. Denn der Historiker Peter Earle bezeichnete den Piraten Henry Morgan “als eine Schlüsselfigur beim wirtschaftlichen und militärischen Aufstieg des britischen Empire”.
Port Royal auf Jamaika
1655 eroberten die Engländer Jamaika von den Spaniern. Die neu gegründete Hauptstadt Port Royal wurde schnell Anlaufstelle und Stützpunkt für Freibeuter aus allen Ländern.
Der englische Gouverneur duldete das nicht nur, sondern sah sie auch als wertvolle militärische Unterstützung bei der Verteidigung der Insel an. So konnten Piraten unter dem Kommando von Henry Morgan von hier aus ungehindert ihre Angriffe auf das spanische Kolonialreich starten. Das wiederum kam Jamaikas Wirtschaft zugute, da die Seeräuber nach ihrer Rückkehr hier einen großen Teil ihrer Beute verkauften oder verprassten und somit dem Wirtschaftskreislauf zuführten.
Eine der reichsten Städte der Karibik
Da sie aber auch gegen französische oder holländische Schiffe vorgingen, konnten die Engländer ihren Einfluss in der Karibik immer weiter ausbauen. Das Piratennest wurde zu einer der reichsten Städte in der Karibik.
Erdbeben und Tsunami
Port Royal wurde durch ein Erdbeben und einem darauf folgenden Tsunami am 7. Juni 1692 fast vollständig zerstört. Ein großer Teil der Stadt versank in den Fluten. Dieser Teil der Piratenstadt wurde im Juli 2025 in das Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen.
Das gegenüberliegende Kingston löste Port Royal danach als Hafenstadt ab. Sie wurde einer der wichtigsten Umschlagplätze für den britischen Sklavenhandel in der Karibik.
Henry Morgan war quasi die Blaupause für das Bild, das heute noch unsere Vorstellung des typischen Piraten prägt. Denn jeder und jede (ja, darunter waren auch Frauen!) wollte sich an den Schätzen der Neuen Länder bereichern, ob im Auftrag eines Staates oder nur für sich selbst – oder für eine gerechter aufgeteilte Welt à la Robin Hood.
Dieser Hintergrund bildet übrigens die Vorlage für die Fantasy-Serie der Disney-Produktion Pirates of the Caribbean*, die Anfang des 18. Jahrhunderts angesiedelt ist.
Ruf nach einem Weltreich
Inzwischen forderten englische Gelehrte immer lauter die Errichtung eines englischen Weltreiches.
Als den Engländern einige weitere Kolonisierungen in der Karibik gelangen, begannen auch sie bald das System von Zuckerrohr-Plantagen der Portugiesen in Brasilien zu übernehmen.
Dafür brauchten sie aber ebenfalls billige Arbeitskräfte. Inzwischen hatte sich der sogenannte Dreieckshandel etabliert. Schiffe aus Europa kauften mit Waren wie Glas oder Gewehre, die in Afrika begehrt waren, von den dortigen Herrschern Sklaven auf. Diese wiederum wurden auf speziell dafür vorbereiteten Schiffen in die Zuckerrohr-Plantagen verschleppt. Der Zucker von dort wurde mit sagenhaften Gewinnspannen nach Europa verschifft.
Siegreiche Kriege gegen die Niederlande und Frankreich
Dazu brauchte man wiederum die Unterstützung durch niederländische Schiffe, die den Rohstoff aufkauften und über den Atlantik brachten. Damit die steigenden Profite nicht zu stark ins Ausland abflossen, beschloss das englische Parlament 1651, dass nur englischen Schiffen der Handel in englischen Kolonien erlaubt wurde.
Das führte zu nachfolgenden Englisch-Niederländischen Seekriegen, die die Engländer für sich entschieden. So konnte England seinen Einfluss in Amerika auf Kosten der Niederländer ausweiten.
Auch gegen Frankreich war die inzwischen stark gewordene englische Flotte erfolgreich.
Australien, Asien und Afrika
1770 nahm James Cook die Ostküste „Neuhollands“ in Australien für das 1707 entstandene Königreich Großbritannien formell als New South Wales in Besitz.
Nach dem Verlust der britischen Kolonie durch den Unabhängigkeitskrieg der späteren USA richtete sich der Expansionskurs der Briten in Richtung Asien und Afrika.
Britisch-Indien entstand nach der Niederschlagung der indischen Rebellion von 1857, indem die bisherigen Besitzungen der Britischen Ostindien-Kompanie in eine Kronkolonie umgewandelt wurden. Tee war dort nun einer der Exportschlager. Es entstanden die sogenannten Teeklipper, schnelle Segelschiffe wie die Cutty Sark.
Von 1880 bis 1900 erlangte Großbritannien die Kontrolle über die Gebiete in einer Linie von Ägypten bis Südafrika.
So entwickelte sich das Britische Weltreich allmählich zum größten Kolonialreich der Geschichte.
Belgien: Gräueltaten und riesige Gewinne
Kurzinfos zu Belgiens Kolonialgeschichte
Beginn: 1885 mit dem Kongo als Privatbesitz von König Leopold II.
Besonderheit: Belgien war keine klassische See- oder Handelsmacht, aber der persönliche Ehrgeiz von Leopold II. machte den Kongo zu einem der brutalsten Kapitel der Kolonialgeschichte.
Wichtige Kolonien:
- Belgisch-Kongo (heute Demokratische Republik Kongo)
- Ruanda und Burundi (nach 1918 von Deutschland übernommen)
Wirtschaftlicher Fokus: Kautschuk, Elfenbein, Palmöl – unter menschenverachtenden Bedingungen
Kritik: Im „Freistaat Kongo“ (1885–1908) kam es zu systematischer Ausbeutung, Zwangsarbeit und Massakern. Millionen Menschen starben. Erst nach internationalem Protest wurde der Kongo 1908 offiziell zur belgischen Kolonie.
Spuren heute: Belgien tut sich bis heute schwer mit der Aufarbeitung. Einige Denkmäler zu Ehren Leopolds wurden inzwischen entfernt oder umgewidmet.
Wie kam es dazu?
Der moderne belgische Staat spaltete sich 1830 nach der Belgischen Revolution vom Königreich der Vereinigten Niederlande ab.
Kautschukboom
Nach 1839 führte die Entdeckung der Vulkanisierung durch Charles Goodyear zu einer enormen Nachfrage nach Kautschuk für die Industrie in Europa und Nordamerika. Er wurde ein wichtiger Rohstoff vieler Produkte während der Industrialisierung.
Kautschukbäume wuchsen im Amazonasgebiet und machten Manaus zum Zentrum des Kautschukbooms. Dort hatten die Ureinwohner bereits um 1.600 v. Chr. den Gummiball aus Kautschuk erfunden.
Aber auch im Kongo gab es Kautschukwälder.
König Leopold II.
1865 kam Leopold II. an die Macht, ein Anhänger kolonialistischer Ideen. Er ließ 1876 den Journalisten und Rassisten Henry Morton Stanley Land im Kongo „kaufen“. Dieser schloss mit etwa 450 einheimischen Machthabern undurchsichtige Verträge ab, in denen diese ihr Land Leopold II. als Privatbesitz überschrieben. Schon bald war der König Besitzer eines Gebietes, das fast 73 Mal so groß war wie Belgien.
Rücksichtslose Ausbeute
Er ließ den Kongo rücksichtslos ausbeuten. Die kongolesische Bevölkerung wurde unter grausamsten Bedingungen zur Arbeit auf den Kautschuk-Plantagen gezwungen. Mehr als 10 Millionen Einwohner:innen kostete es das Leben, viele weitere Millionen wurden verstümmelt.
Unermessliche Gewinne
Schätzungen gehen von 125 bis 500 Millionen Euro aus, die in die Privatschatulle von Leopold II. flossen. Mit diesem Blutgeld finanzierte er Prachtbauten wie das heutige “Königliche Museum für Zentral-Afrika” in der Nähe von Brüssel.
Noch bis 2005 waren dort keinerlei Informationen über die Gräueltaten zu sehen. Erst nach der Renovierung 2018 besann man sich auf die grausame Geschichte.
Deutschland: Kolonien als Prestigeobjekte
Kurzinfos zu Deutschlands Kolonialgeschichte
Beginn: 1884 mit der Gründung erster „Schutzgebiete“
Besonderheit: Das Deutsche Kaiserreich stieg erst spät in den Kolonialismus ein – mit großer symbolischer Aufladung und aggressiver Expansion. Das „Platz an der Sonne“-Zitat von Kanzler von Bülow ist berühmt.
Wichtige Kolonien:
- Deutsch-Ostafrika (Tansania, Ruanda, Burundi)
- Deutsch-Südwestafrika (Namibia)
- Togo, Kamerun
- Kiautschou (China), Pazifikgebiete (z. B. Samoa)
Wirtschaftlicher Fokus: Landwirtschaftliche Monokulturen, Bergbau, Prestigeobjekte
Kritik: In Namibia verübte das Deutsche Reich 1904–1908 den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts – an den Herero und Nama. Es war ein grausames Kapitel deutscher Kolonialgeschichte, das lange ignoriert wurde.
Spuren heute: Viele Straßennamen und Denkmäler werden aktuell hinterfragt oder umbenannt. Deutsch wird in Namibia noch gesprochen, historische Bauten existieren bis heute.
Warum wurde Deutschland zur Kolonialmacht?
Im Vergleich zu Spanien, Portugal, Großbritannien oder Frankreich war Deutschland spät dran. Das hatte mehrere Gründe:
Vor der Reichsgründung war Deutschland in viele Einzelstaaten zersplittert. Preußen, Bayern, Sachsen und andere Länder hatten weder die Mittel noch das Interesse, eigenständige Kolonien aufzubauen. Dennoch profitierten einige Länder bereits früh vom lukrativen Gold-, Elfenbein- und Sklavenhandel wie z. B. Brandenburg mit der Brandenburgisch-Africanischen Compagnie.
1871 mit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs änderte sich das schlagartig.
Nationalstolz und Prestigedenken
Denn schnell entwickelte sich ein starker Nationalstolz. Deutschland wollte als Großmacht unter den „Weltreichen“ mitspielen.
Kolonien galten als Statussymbol und Beweis für zivilisatorische Überlegenheit. Sie passten perfekt ins Bild eines Reiches, das sich modern, mächtig und global vernetzt zeigen wollte.
Erste Schutzgebiete
Der damalige Reichskanzler Bismarck war zunächst gegen koloniale Bestrebungen, obwohl der Ruf danach lauter wurde.
Erst 1882, als der Bremer Tabakhändler Adolf Lüderitz um Schutz für seine Handelsniederlassung an der südwestafrikanischen Küste bat, änderte Bismarck seine Meinung.
Erste Kolonien 1884
1884 stellte Bismarck nach britischem Vorbild nun mehrere Besitzungen deutscher Kaufleute unter den Schutz des Deutschen Reichs. Es entstanden die Kolonien Deutsch-Südwestafrika, Deutsch-Ostafrika, Kamerun oder Deutsch-Neuguinea und viele weitere. In nur einem Jahr wurde das nach dem britischen und französischen flächenmäßig drittgrößte Kolonialreich geschaffen.
Deutschland im Kolonialfieber
So entstand in der deutschen Bevölkerung eine Art „Kolonialfieber“. Kolonialwarenläden wurden in. Diese zunächst spezialisierten Geschäfte entwickelten sich später zu Lebensmittelgeschäften mit breiterem Angebot. Sie waren Vorläufer der heutigen Supermärkte.
Der Name Edeka stammt noch heute davon ab. Es war die Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Halleschen Torbezirk zu Berlin – abgekürzt zu E. d. K.
Kongokonferenz
Die Kolonien dienten Bismarck aber auch als Verhandlungsmasse. So wurde bei der Kongokonferenz 1884/85 in Berlin Afrika unter den Großmächten aufgeteilt.
Militär und Expansion
Das Kaiserreich war stark vom Militär geprägt. Kolonien boten Gelegenheit zur Aufrüstung, Truppenstationierung und weltweiter Präsenz der Marine. Stützpunkte in Afrika, Asien und im Pazifik sollten auch strategisch nützlich sein – für Einflusszonen, Handelswege oder spätere politische Expansionen.
Platz an der Sonne
Der spätere Reichskanzler von Bülow sprach 1897 vom „Platz an der Sonne“, den Deutschland ebenfalls beanspruche. Gemeint war ein Platz unter den imperialen Großmächten.
Wirtschaftliche Interessen
Deutsche Unternehmen und Handelsgesellschaften versprachen sich große Gewinne durch Rohstoffe (z. B. Baumwolle, Kautschuk, Kupfer) und neue Absatzmärkte. Auch das wachsende Bevölkerungswachstum und die Industrialisierung führten dazu, dass man „Lebensraum“ und „Exportchancen“ außerhalb Europas suchte – zumindest aus Sicht der Eliten.
Ideologie und Rassismus
Wie bei anderen Kolonialmächten spielte auch in Deutschland die Idee von „Zivilisierungsmissionen“ eine Rolle. Die einheimischen Bevölkerungen galten in der rassistisch geprägten Denkweise vieler Zeitgenossen als “wild”, „unzivilisiert“ und somit „unterlegen“.
Diese Ideologien dienten als Rechtfertigung für Ausbeutung, Gewalt und Unterdrückung.
Völkermord an den Herero und den Nama
Durch immer größere Gebietsansprüche der deutschen Kolonisatoren kam es in Deutsch-Südwestafrika 1904 (heute Namibia) zu einem Aufstand der indigenen Bevölkerung, die um ihre fruchtbaren Weidegründe und ihre Existenz fürchteten. Das führte zum Völkermord an den Herero und Nama, dem bis 1908 etwa 70.000 Menschen zum Opfer fielen.
Der erste Weltkrieg beendete alle kolonialen Träume Deutschlands.
Italien: Der späte Kolonialtraum
Kurzinfos zu Italiens Kolonialgeschichte
Beginn: Ende des 19. Jahrhunderts, vor allem ab 1882
Besonderheit: Italien war spät dran und strebte stark nach Anerkennung als Großmacht. Der Kolonialerfolg blieb begrenzt, der Widerstand war oft stark wie z. B. in Äthiopien.
Wichtige Kolonien:
- Eritrea, Somalia, Libyen
- Kurzzeitig Teile Äthiopiens (ab 1935 unter Mussolini)
- Rhodos, Dodekanes-Inseln, Albanien
Wirtschaftlicher Fokus: Landwirtschaft, Migration von Italiener:innen, strategische Kontrolle
Kritik: Der Angriff auf Äthiopien 1935 war völkerrechtswidrig. Italien setzte Giftgas ein und verübte Kriegsverbrechen. Viele Kolonien brachten kaum wirtschaftlichen Nutzen, dafür politische Spannungen.
Spuren heute: In Libyen und Ostafrika finden sich noch bauliche und sprachliche Spuren. Die italienische Öffentlichkeit diskutiert ihre Kolonialgeschichte bis heute eher zurückhaltend.
Warum wollte Italien Kolonien?
Wie das Deutsche Reich wurde ein einheitliches Königreich Italien sehr spät durch Garibaldi 1861 gegründet. Die Stadtrepubliken Genua und Venedig waren längst untergegangen. Dennoch gab es enorme Unterschiede zwischen dem wohlhabenden Norden und dem armen Süden. Dort erhoffte man sich Reformen des Großgrundbesitzes, die aber ausblieben.
In Sizilien entstand die Mafia.
Auswanderungsdruck und Prestige
Infolge der Armut wanderten etwa 14 Millionen Italiener:innen aus und suchten zwischen 1876 und 1915 ihr Glück in Nord- und Südamerika. Durch diesen Auswanderungsdruck und den durch die Industrialisierung erhöhten Bedarf an Rohstoffen versuchten die damaligen italienischen Regierungen in Richtung eigener Kolonien zu kanalisieren.
Auch die wohlhabendere Bevölkerung wollte mit den anderen Nationen in Bezug auf Auslandsbesitzungen nachziehen. Die italienischen Regierenden orientierten sich dabei vor allem in Richtung Nordafrika und Ostafrika.
Erste Kolonie Eritrea
Den Anfang machte wie im Deutschen Reich eine Handelsgesellschaft. Das Unternehmen Rubattino kaufte 1869 einen Küstenstreifen in Eritrea.
1880 übernahm das Königreich Italien die militärische Schutzherrschaft und zwei Jahre später die alleinige Kontrolle. Schritt für Schritt entstand daraus die Kolonie Eritrea (offiziell ab 1890). Wenig später folgte Italienisch-Somaliland im Süden.
Beide Gebiete waren allerdings wirtschaftlich kaum ertragreich, hatten kaum Infrastruktur und forderten hohe Kosten. Doch für die italienische Regierung zählte zunächst vor allem der symbolische Wert.
Bittere Niederlage in Äthiopien
Ein Schlüsselmoment war 1896 die Schlacht von Adua: Italien wollte auch das mächtige Kaiserreich Abessinien (Äthiopien) unterwerfen – doch es kam anders. Die italienischen Truppen wurden von den Äthiopiern vernichtend geschlagen.
Diese Niederlage war ein Schock für Italien – das einzige europäische Land, das im Zeitalter des Hochimperialismus von einer afrikanischen Armee besiegt wurde.
Für Äthiopien war es ein Triumph und ein bis heute ein Symbol des antikolonialen Widerstands.
Italienisch-Türkischer Krieg
1911 warf die italienische Regierung ihr Auge auf Tripolitanien und Cyrenaika, zwei Regionen in Libyen, die zum Osmanischen Reich gehörten.
So stellte sie am 26. September 1911 ein Ultimatum, das die sofortige Abtretung forderte. Als Sultan Mehmed V. die Forderungen zurückwies, erklärte Italien den Krieg.
1912 verlor das Osmanische Reich und musste die Gebiete und zusätzlich auch Rhodos und weitere Inseln an Italien abtreten.
Libyen leistet Widerstand
In den libyschen Gebieten rechnete der italienische Staat mit einer schnellen Kontrolle, aber die libysche Bevölkerung leistete jahrelang erbitterten Widerstand. Vor allem in Kyrenaika unter der Führung des legendären Freiheitskämpfers Omar al-Mukhtar.
Erst ab den 1930er-Jahren gelang es Italien, diesen Widerstand mit extremer Brutalität zu brechen. Dabei kamen Massenhinrichtungen, Zwangsumsiedlungen und Internierungslager zum Einsatz.
Es war eine der gewaltsamsten Phasen der gesamten italienischen Kolonialgeschichte.
Neuer Anlauf unter Mussolini: Expansion mit Gewalt
Unter Benito Mussolini wurde der Kolonialgedanke weiter verfolgt, diesmal aggressiver und ideologisch aufgeladen. Der faschistische Diktator träumte von einem neuen „Römischen Reich“. Dafür wurde u. a. Rhodos als Stützpunkt für weitere Expansionen ausgebaut. Dort herrschte der Gouverneur de Vecchi mit brutalsten Methoden, die selbst Mussolini zu viel waren.
Giftgas und brutale Gewalt
1935 ließ Mussolini Äthiopien erneut angreifen, diesmal mit moderner Technik, Giftgas und brutaler Gewalt. Die Eroberung war völkerrechtswidrig, löste internationale Kritik aus, doch das „Italienische Ostafrika“ (Abessinien, Eritrea, Somalia) wurde ausgerufen. Wirtschaftlich war auch dieses Projekt ineffektiv und kostspielig.
Niedergang nach dem Zweiten Weltkrieg
Mit der Niederlage im Zweiten Weltkrieg verlor Italien alle Kolonien. Äthiopien wurde wieder unabhängig. Libyen wurde 1951 ein souveräner Staat. Somalia erhielt 1960 die Unabhängigkeit.
Der heutige Wohlstand Europas
Nahezu alle europäischen Länder waren am Sklavenhandel und Kolonialismus beteiligt. Auch Dänemark, Schweden, Österreich und sogar die „neutrale“ Schweiz waren aktiv und profitieren noch heute davon.
Der enorme Wohlstand der europäischen Länder liegt zum großen Teil in seiner Kolonialgeschichte und in der Ausbeutung der ehemaligen Kolonien begründet.
Kolonalismus ist immer noch in unseren Köpfen
Und der Kolonialismus ist immer noch in unseren Köpfen verhaftet wie die Autorin Grada Kilomba im lesenswerten Buch “Plantation Memories” aufzeigt. Denn der alltägliche Rassismus herrscht selbst in gebildeten Schichten noch vor, obwohl wir meinen, davon weit entfernt zu sein.
Siegbert Mattheis
Siegbert Mattheis, Jahrgang 1959, ist seit seinem ersten Italienaufenthalt 1977 vom mediterranen Lebensgefühl begeistert. Seitdem bereist er mehrmals im Jahr die Länder rund um das Mittelmeer. Nach seinen Studien Kommunikationsdesign, Philosophie, Wissenschaftstheorie und Kunstgeschichte gründete er eine Werbeagentur, die er seit 1998 gemeinsam mit seiner Frau Claudia Mattheis führt. 2002 bauten beide gemeinsam Ambiente–Mediterran.de auf, das inzwischen größte Lifestyle-Magazin rund um die mediterrane Kultur. Darüber hinaus ist er Fachjournalist und Fotograf, begeisterter Hobbykoch und Liebhaber stilvoller Einrichtung. Gründliche Recherche und Liebe zum Detail gehören zu seinen Leidenschaften. Mit seiner Frau lebt er in Berlin Prenzlauer Berg.